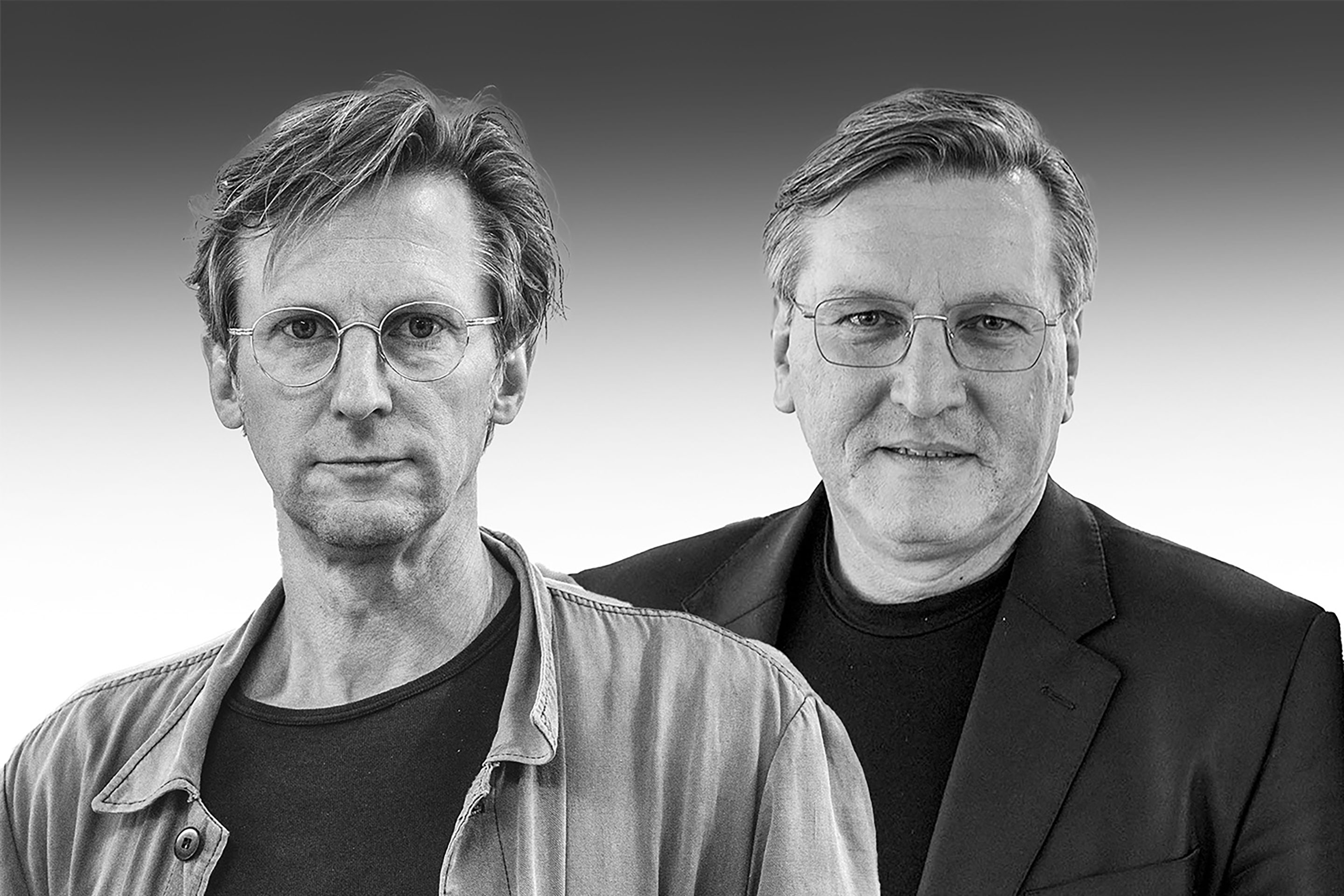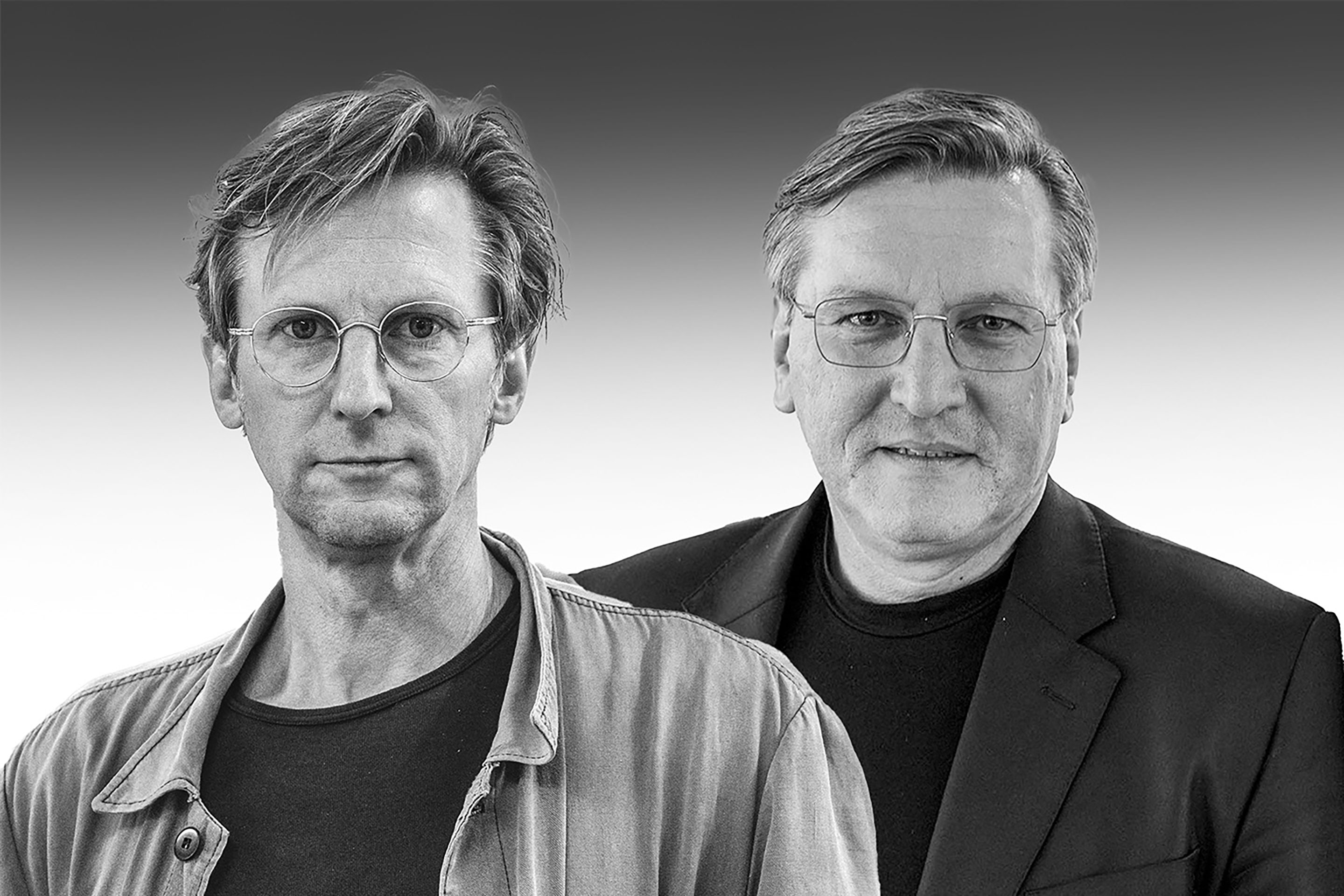
Im Herbst wird zum dritten Mal der SIA Masterpreis Architektur verliehen. Die von SIA und Architekturrat initiierte Auszeichnung bietet einen Überblick über die hiesige Architekturausbildung. Wir sprachen mit zwei Mitgliedern des Architekturrats, Beat Waeber und Christoph Gantenbein, über das neue Miteinander von Fachhochschulen und Universitäten.
Der SIA Masterpreis Architektur wurde 2022 neu lanciert und umfasst nun alle neun Schweizer Hochschulen, die einen Masterabschluss in Architektur anbieten. Ist die Neulancierung gelungen?
Beat Waeber: Aus Sicht der ZHAW hat sich die Neulancierung mit dem Einbezug der Fachhochschulen gelohnt. Der SIA-Preis zeigt unseren Anspruch, Masterstudierende auszubilden; die Ergebnisse der Ausbildung präsentieren wir gerne im Rahmen dieser Konkurrenz. In der Ausstellung «Sign of the Times» im Schweizerischen Architekturmuseum S AM in Basel, die die prämierten Projekte der vergangenen beiden Jahre zeigt, sieht man die aktuellen Themen, Fragestellungen und Herangehensweisen, die von den Projekten behandelt werden.
Christoph Gantenbein: Beat Waeber und ich haben in diesem Gespräch zwei Rollen, einerseits als Vertreter unserer Schulen, andererseits als Mitglieder des Architekturrats. Aus Sicht des Architekturrats ist der Preis ein grosser Erfolg. Dass diese Auszeichnung schon zum dritten Mal in dieser Form verliehen wird und die Hochschulen geschlossen dahinterstehen, ist ein Zeichen dafür, dass der Architekturrat als Institution funktioniert und zu einer aktiven Vereinigung geworden ist. Das ist sehr wichtig in instabilen Zeiten wie diesen. Jedes Netzwerk, in dem sich Menschen austauschen, trägt zur Stabilität bei. Dass das auch in der Architektur stattfindet, ist ein wichtiger Schritt.
Gibt es etwas, was sich der Architekturrat im Zusammenhang mit der Auszeichnung wünschen würde? Etwa eine Auszeichnung auf Stufe Bachelor?
Beat Waeber: Der SIA Masterpreis ist ein wichtiger Pfeiler im Diskurs über die Qualität der Architekturausbildung. Dazu ein kleiner Exkurs: Der Architekturrat wurde 2008 als Diskussionsplattform unter den universitären Hochschulen und den Fachhochschulen initiiert, um im Rahmen der Bologna-Reform die Architekturlehre in der Schweiz zu harmonisieren und die Kompetenzprofile der Bachelor- und Masterprogramme zu definieren. Auf der Grundlage des dualen Bildungssystems galt es, neben der Bachelor- auch die Masterausbildung zwischen den Hochschulen zu koordinieren. Heute sind sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge an den Universitäten und den Fachhochschulen etabliert. Auch die einstige Unterscheidung bei der Forschung – Fachhochschulen betreiben angewandte Forschung, Universitäten Grundlagenforschung – ist inzwischen überholt. Gemäss dem seit 2015 gültigen Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz teilen sich Bund und Kantone die Verantwortung für die Fachhochschulen. Dies generiert unterschiedliche didaktische und inhaltliche Ausbildungskonzepte. Umso wichtiger scheint es daher, dass der Architekturrat den Diskurs über die Architekturausbildung fördert und unterstützt. Ein gutes Instrument ist der kompetitive Vergleich, wie er im Rahmen des SIA Masterpreises stattfindet. Ob es auch einen SIA Bachelorpreis geben soll, kann man diskutieren. Allerdings sind die Kompetenzprofile und die Curricula der Fachhochschulen noch zu unterschiedlich, um die Aufgabenstellungen und deren Studierendenprojekte vergleichen zu können.
Christoph Gantenbein: Hier vertritt die ETH Zürich eine andere Position als die Fachhochschulen. Der oder die typische Studierende an der ETH hat die Matura und steigt anschliessend direkt ins Studium ein. Nach drei Jahren ist es für einen individuellen architektonischen Ausdruck noch zu früh. An den Fachhochschulen ist das anders. Hier nehmen oft junge Berufsleute mit einer Vorbildung aus dem Baubereich das Studium auf. Die Architektur wird immer komplexer. Daher stehe ich einer Ausbildung ausschliesslich auf Bachelorstufe kritisch gegenüber. Ich persönlich – und ich denke, ich kann hier auch für die ETH Zürich sprechen – würde es nicht unterstützen, diesen Abschluss mit einem eigenen Preis zu zelebrieren. Viel eher würde ich junge Menschen ermutigen, nach der Bachelorausbildung einige Zeit in der Praxis zu arbeiten, aber dann den Masterabschluss anzuschliessen. Die Befähigung, selbstständig und kritisch zu denken, ist in unserem Beruf von zentraler Bedeutung. Diese Fähigkeit erlangt man meiner Meinung nach erst auf Masterstufe.
Beat Waeber: Wir sehen das genauso. Der Bachelorabschluss nach sechs Semestern gilt als Berufsbefähigung. Ein umfassendes Architekturstudium beinhaltet auch an den Fachhochschulen zehn Semester, inklusive des Masterstudiengangs.
Auffallend bei den eingereichten Arbeiten ist, dass sie die Grenzen der «Objektarchitektur» mit dem Architekten, der Architektin als Autor oder Autorin hinter sich lassen, und dies nicht nur in der Thematik, sondern auch in der Wahl der Darstellung. Ist das ein genereller Trend an den Schulen oder reichen die Schulen nur diese Art von Arbeiten ein?
Beat Waeber: Ich denke, dass die Arbeiten die aktuell unterrichtete und von den Studierenden nachgefragte Baukultur abbilden. Die Architekturausbildung hat sich gewandelt. Wir haben im Architekturrat intensiv über das Berufsbild diskutiert. Als Ausbildungsstätte für Architektinnen und Architekten müssen wir uns nicht nur mit der aktuellen Berufspraxis auseinandersetzen, sondern auch ein Konzept vorweisen, welche Kompetenzen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren vermitteln werden. Die Studierendenarbeiten zeigen beispielhaft, dass sich die architektonischen Fragestellungen geändert haben.
Bereitet diese Herangehensweise die Studierenden auf den Beruf vor oder entsteht so ein Graben zwischen Ausbildung und Praxis?
Beat Waeber: Angesichts des Klimawandels und des hohen Anteils der Bauindustrie an der CO2-Belastung agiert die aktuelle Baupraxis noch zu verhalten. Die Thematik des nachhaltigen Bauens sollte an den Architekturschulen ganz oben auf der Agenda stehen und den Studierenden umfassend vermittelt werden. Hier müsste die Baupraxis den Schulen folgen und nicht umgekehrt. Es gibt dazu einen Aphorismus von Luigi Snozzi, von Mitte der 1970er-Jahre: «Wenn sich eines Tages die Absolventen einer Architekturschule nicht in den Büros verwerten lassen, dann wird die Schule einen grossen Schritt nach vorne gemacht haben.» Die Aussage hat immer noch Gültigkeit. Wir können unsere Studierenden nicht nur für die aktuelle Praxis ausbilden, sondern sollten sie für das Verstehen von übergeordneten Fragen und Zusammenhängen befähigen. An unserer Architekturschule beispielsweise sind die Masterarbeiten eng an hochschuleigene Forschungsprojekte geknüpft. Es gibt also eine Wechselwirkung von Lehre und Forschung. Zudem sind alle Masterthesis-Projekte individuelle Arbeiten, deren Thematik sich die Studierenden selbst erarbeiten. Die Fragestellungen sind also ein Abbild der Themen, die an unserer Schule im Zusammenhang mit der Forschung behandelt werden.
Christoph Gantenbein: Natürlich gibt es auch nicht nur die eine Praxis. Das Berufsbild ist divers geworden, das Bauen an sich ist nur eine von vielen Optionen. Daher ist es wichtig, dass die Vielschichtigkeit des Berufs in der Ausbildung abgebildet wird. Als Architekt ist man Generalist. In der Ausbildung lernt man eine Methodik, mit der sich komplexe Fragestellungen beantworten lassen. Vor zehn, 15 Jahren war das nicht so. Damals war die Fragestellung vorgegeben, und das Resultat dadurch auf gewisse Weise vorweggenommen. Doch unsere Welt ist derart vielschichtig geworden, dass ich selbst in klassischen Bauprojekten schon heute mindestens die Hälfte der Zeit nicht mehr mit Arbeiten am Projekt verbringe, sondern mit solchen am Projektumfeld. Wir sind nicht einfach Befehlsempfänger. Prozessuale Fragen sind wichtiger geworden. Als Architekt muss man in der Lage sein, eine komplexe Situation zu sortieren und auch eine Meinung dazu zu haben. Insofern denke ich, dass es auch für die Praxis von zentraler Bedeutung ist, dass Studierende sich ihre Aufgabe selbst kritisch stellen. Andererseits braucht es auch das bauliche Know-how, und das kommt bei diesem Ansatz ein wenig unter die Räder. Die Frage, wie die Studierenden, die dann doch irgendwann in einem Büro sitzen und an einem Projekt arbeiten, zu diesem Wissen kommen, steht natürlich im Raum.
Gibt es etwas, das Sie für die zukünftige Durchführung des SIA Masterpreises anregen würden?
Christoph Gantenbein: Wir müssen den Anspruch haben, unsere Themen in die Öffentlichkeit zu tragen! Ich bin sehr glücklich über die Ausstellung im S AM und war beeindruckt vom hohen Niveau der Masterarbeiten, die man dort zu sehen bekommen hat. Es ist auch schön, dass der Ursprung der einzelnen Arbeiten nicht unbedingt mehr erkennbar ist. Gut ist, dass der Wandel des Berufsbilds auf diese Weise sichtbar wird. Die Ausstellung hat hier wichtige Übersetzungsarbeit geleistet.
Beat Waeber: Ich würde es begrüssen, wenn dieses Format institutionalisiert würde. Die Ausstellung zeigt, dass das architektonische Niveau an allen Hochschulen hoch ist, an den Fachhochschulen wie an den Universitäten. Bis 2022 konnte das nicht abgebildet werden, da nur letztere für den Preis zugelassen waren. Eine regelmässige Ausstellung würde helfen, den Diskurs über die hiesige Architekturausbildung zu kultivieren.
Christoph Gantenbein: Dass die Ausstellung zustande kam, war auch ein glücklicher Zufall. Ich möchte an dieser Stelle im Namen des Architekturrats allen Schulen danken, die das Projekt so kurzfristig und vorbehaltlos unterstützt haben. Dieser Projektcharakter würde eventuell verloren gehen, wenn man das Format institutionalisiert. Vielleicht sind die ausgezeichneten Arbeiten künftig im Schweizer Pavillon auf der Architekturbiennale zu sehen oder in einem anderen internationalen Kontext. Wichtig ist, dass man für den Preis Energie und die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit mobilisieren kann. Das finde ich wichtiger als die Regelmässigkeit.